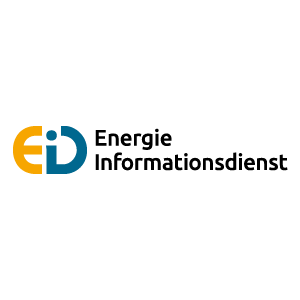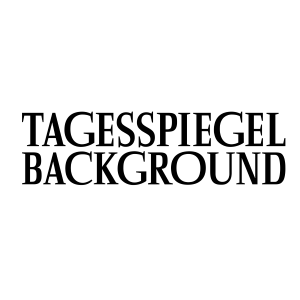Klimaschutz mit Krisenschutz: Energiepolitische Weichenstellung im Wahljahr 2025
Zeitgleich mit der zweitägigen Veranstaltung am 26. und 27. März 2025 in Berlin begann der Dialog mit der neuen Bundesregierung, in der erste Impulse für die energiepolitische Ausrichtung in der neuen Legislaturperiode gesetzt wurden. Unter dem Leitthema „Klimaschutz mit Krisenschutz: Energiepolitische Weichenstellung im Wahljahr 2025“ diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft über ihre Erwartungen und Forderungen an die neugewählten politischen Entscheidungsträger. Im Mittelpunkt des intensiven Austausches stand die Auseinandersetzung mit den multidisziplinären Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dabei wurde branchenübergreifend und lösungsorientiert über zentrale Aspekte der Energiewende sowie über deren realistische Umsetzbarkeit beraten.
Während der beiden Veranstaltungstage, an denen 65 Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt waren, entwickelte sich ein dynamischer Dialog. Dieser war geprägt von einem geschärften Bewusstsein für die Spannungsfelder zwischen den ambitionierten Zielen im Klimaschutz und der gleichzeitigen Notwendigkeit eines robusten Krisenschutzes.
Das Bestreben, eine interdisziplinäre Plattform für den Austausch zu schaffen, erhielt durch die gezielte Einbindung der Diskussion über notwendige technologische Innovationen sowie über geeignete politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zusätzliche Bedeutung. In diesem Kontext setzte die sechste Ausgabe von „ENERGIE.CROSS.MEDIAL“ nicht nur ein weiteres starkes Signal in der laufenden Energiewendedebatte, sondern brachte auch neue Denkanstöße für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Energiepolitik hervor.
Im Eröffnungsplenum des ersten Veranstaltungstages kamen verschiedene Stakeholder der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu Wort, um über die drängendsten Herausforderungen der Branche zu referieren. In ihren Beiträgen skizzierten die Experten ihre Erwartungen an eine umfassende und koordinierte Energiewende, die nicht nur technologische, sondern auch wirtschaftliche und politische Aspekte berücksichtigt.
Prof. Dr.-Ing. Martin Braun, Institutsleiter, Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), betonte die Notwendigkeit eines strukturierten Übergangs zur Nutzung erneuerbarer Energien. Neben Versorgungssicherheit und Energiesouveränität seien bezahlbare Industriestrompreise und die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte entscheidend. Digitalisierung und KI könnten zur Netzstabilisierung beitragen.
Dr. Frank Meyer, Geschäftsführer, Robert Bosch GmbH, forderte angesichts globaler Herausforderungen klare politische Leitlinien, eine konsistente Förderpolitik und verlässliche Rahmenbedingungen, um Investitionen in die Transformation zu ermöglichen.
Nikolaus Valerius, CEO, RWE Generation SE, kritisierte das Ungleichgewicht im energiepolitischen Dreieck. Versorgungssicherheit müsse stärker berücksichtigt werden. Er sprach sich für dekarbonisierungsfähige Kraftwerke, Technologieoffenheit und eine Weiterentwicklung des Emissionshandels aus.
Prof. Dr. Jörg Steinbach, Minister a.D., Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg, hob hervor, dass die Energiewende auch soziale und mentale Veränderungen erfordere. Neben gezielten Investitionen brauche es klare gesetzliche Rahmenbedingungen, transparente Kommunikation und eine stärkere Förderung von Forschung und Bildung.
Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung, 50Hertz Transmission GmbH, warnte vor übermäßiger Planungssteuerung. Die Energiewende müsse marktwirtschaftlich tragfähig bleiben. Er forderte realistische Bedarfsanalysen, effizientere Prozesse zur Sicherung der Versorgung und eine offene Debatte über Netzausbau und Kostenverteilung.
Herausforderungen der Elektromobilität und mögliche Lösungsansätze
Die parallelen Themensessionen des Vormittags widmeten sich unter anderem den Herausforderungen der Elektromobilität und deren entsprechenden Lösungsansätzen. Oliver Hoch, Bereichsleiter Batterie-Elektrische Mobilität und Ladeinfrastruktur bei der NOW GmbH, wies in seinem Impulsreferat aufdie Bedeutung einer flächendeckenden Lade- und Tankinfrastruktur hin, die nicht nur für Pioniernutzer, sondern für den Massenmarkt ausgelegt sein müsse. Besonders im Nutzfahrzeugbereich schreite der Markthochlauf rasch voran – mit Batterietechnologie als dominierender Antrieb und Wasserstoff als ergänzender Lösung.
In der anschließenden Diskussion mit Dr. Christoph Ploß, MdB (CDU/CSU), Swantje Michaelsen, MdB (Bündnis 90/Die Grünen), Maik Beermann, Senior Vice President bei der DEKRA, Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V., und Christoph Schuler, Head of Public Affairs bei MAN Truck & Bus SE, unter der Moderation von Uta Maria Pfeiffer, Abteilungsleiterin Mobilität und Logistik beim Bundesverband der Deutschen Industrie, wurde verdeutlicht: Der wirtschaftlich bislang wenig rentable Ausbau der Ladeinfrastruktur, insbesondere das Depotladen, erfordere gezielte staatliche Förderung, ausreichende Netzkapazitäten und langfristige Planungssicherheit. Ein grüner Finanzierungskreislauf nach dem Prinzip „Straße finanziert Straße“ wurde als notwendig erachtet. Gleichzeitig dürfe die Regulierung keine Innovationen hemmen, sondern müsse Investitionen gezielt fördern.
Auf energie- und verkehrspolitischer Ebene wurden eine Deckelung des Strompreises, die Senkung von Stromsteuern sowie eine europaweit koordinierte Ladeinfrastruktur gefordert. Auch der Gebrauchtfahrzeugmarkt müsse stärker in den Fokus rücken – etwa durch eine verpflichtende Batteriezertifizierung. Dr. Ploß sprach sich für Technologieoffenheit, den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und eine solide Finanzierung aus. Michaelsen betonte die Notwendigkeit klarer politischer Leitplanken und zielgerichteter Förderprogramme. Beide unterstrichen die Bedeutung der Schiene und die Priorität einer Bestandssanierung im Straßenbereich.
Das Energieversorgungssystem steht auf dem Kopf – was jetzt für Abhilfe sorgen kann
Ein weiteres Thema der parallelen Themensessions war das Energieversorgungssystem. Den Auftakt bildeten die Impulse von Rainer Kleedörfer, Leiter Zentralbereich Unternehmensentwicklung bei N-ERGIE, Andreas Steidle, Leiter Energy Management & Solutions bei Evonik, Dr. Hans Wolf von Koeller, Leiter Energiepolitik bei STEAG/Iqony, und Markus Stombrawe, Leiter Energiemarkt und Systembilanz bei Amprion, in denen sie die aktuellen Herausforderungen des Energieversorgungssystems und ihre Lösungsansätze und Sichtweisen kurz vorstellten.
Die anschließende Podiumsdiskussion unter der Moderation von Eberhard von Rottenburg, Stellvertretender Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie, fokussierte sich auf Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung im Energieversorgungssystem. Stombrawe sah in zusätzlichen Regelzonen keine Lösung und bewertete Großbatteriespeicher als wenig entlastend für regionale Netze. Einigkeit bestand in Bezug auf die Notwendigkeit einer Effizienzsteigerung des bestehenden Systems sowie auf der vordringlichen Schaffung eines Business Case für die Energiewende. Dr. von Koeller betonte zudem, man müsse die Ausgangslage neu begutachten und die Zielsetzung anpassen anstelle alter Pläne zu folgen. Einen weiteren Diskussionspunkt stellte die zukünftige Verwendung des Klima- und Transformationsfonds durch die Bundesregierung dar. Dabei wurde die Sorge geäußert, dieser Fond würde ziellos oder ineffizient eingesetzt werden. Vielmehr müsse sich die Bundesregierung „ehrlich machen“ und inhaltlich kluge Entscheidungen treffen, so Kleedörfer. Steidle betonte die besondere Bedeutung einer Mischung aus Unterstützung von Pilotprojekten und dem Infrastrukturausbau.
Wettbewerbsfähige Strompreise – Welche Maßnahmen sind jetzt erforderlich?
Am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages widmete sich die Plenarveranstaltung der Problematik der hohen Strompreise in Deutschland sowie der Frage, welche Maßnahmen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit sorgen könnten. Einen Überblick über Zahlen, Daten und Fakten sowie verschiedene Prognosen zur Strompreis- und Netzentgeltentwicklung gab Dr. Philip Schnaars, Leiter Forschungsbereiche Strommarkt und Regulierung des Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI).
In der sich anschließenden Podiumsdiskussion unter der Moderation von Ulrike Drachsel, Geschäftsführerin des Forum für Zukunftsenergien und der EFO Energie Forum GmbH vertieften Tetiana Chuvilina, Head of Political Affairs bei TenneT, Matthias Belitz Geschäftsführer der EID, Markus Hagel, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation bei Trianel, und Dr. Schnaars die Eingaben. Debattiert wurde über die verschiedenen Möglichkeiten zur Senkung der Netzentgelte, unter anderem durch das Wiedereinbinden von Reservekraftwerken in das Netz und die Steigerung von Flexibilitäten auf Seiten der Verbraucher aber auch der Erzeuger. Dabei sei es wichtig, stets auf die Systemdienlichkeit und Effizienz der Maßnahmen zu achten und das Gesamtsystem im Blick zu behalten. Auch das Einführen mehrerer Stromgebotszonen stand zur Diskussion. Dazu wurde die Auffassung vertreten, dass dies jedoch nur geringe Auswirkungen auf den Strompreis habe und wenig Planungsunsicherheit schaffe.
Aufbau eines Weltmarktes für den Import grüner Moleküle am Beispiel Methanol
In den parallelen Themensessions des Nachmittags ging es einerseits um den Aufbau eines Weltmarkts für den Import grüner Moleküle, der am Beispiel Methanol betrachtet wurde. Andererseits wurde in der parallellaufenden Themensession die kommunale Energiewende näher betrachtet.
Prof. Dr. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), wies darauf hin, dass derzeit rund 80 Prozent des Energiebedarfs durch molekulare Energieträger gedeckt würden – ein Anteil, der durch Elektrifizierung sinken werde. Der Anteil erneuerbarer Moleküle liege jedoch erst bei 11,5 Prozent. Ohne Fortschritte in diesem Bereich seien die Klimaziele nicht erreichbar. Eine resiliente Energieversorgung erfordere daher nachhaltige Moleküle wie grünen Wasserstoff oder Methanol und ebenso stabile regulatorische Rahmenbedingungen.
Michael Bakman, Seniorexperte bei der Deutschen Energie-Agentur (dena), erklärte, dass erneuerbares Methanol als klimafreundlicher Ersatz für fossile Rohstoffe hohes Potential biete – sowohl als Energieträger als auch als chemischer Grundstoff. Bestehende Prozesse könnten auf erneuerbare Quellen umgestellt werden. Für den Markthochlauf seien jedoch klare Rahmenbedingungen und Investitionssicherheit entscheidend.
Prof. Dr. Christopher Hebling, Direktor International am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) betonte, dass die Energiewende weltweit unterschiedlich verlaufe und regionale Besonderheiten berücksichtigen müsse. Der Weg zur Klimaneutralität führe eindeutig über technologische Innovation, internationale Regeln und gezielte Investitionen – insbesondere im globalen Süden.
Oleksandr Siromakha, Head of Sustainable Fuels bei Mabanaft, wies darauf hin, dass Methanol insbesondere bei der Dekarbonisierung von Schifffahrt, Industrie und Luftfahrt eine zentrale Rolle spielen könne. Voraussetzung seien Abnahmeverträge, passende Infrastruktur und stabile Rahmenbedingungen, um Investitionen zu ermöglichen und den Markthochlauf zu beschleunigen.
Prof. Dr. Christian Küchen, Dr. Carsten Rolle, Geschäftsführer des Weltenergierat-Deutschland, Claudia Müller, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, und Dr. Falk Bömeke, Referatsleiter “Grundsatzfragen der bilateralen Klima- und Energiekooperation; Kooperationen in Nordamerika, Ostasien, Ozeanien und Türkei“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), diskutierten anschließend unter der Moderation von Alexander von Gersdorff, Pressesprecher und Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), über die Rolle internationaler Energiepartnerschaften, regulatorischer Rahmenbedingungen und Investitionen für eine klimaneutrale Energieversorgung bis 2045. Müller betonte die Notwendigkeit technologieoffener Antriebslösungen, um Nutzungskonflikte – etwa bei Biomasse – zu vermeiden. Neben Elektromobilität müssten auch alternative Technologien wie Dual Fuel gefördert werden. Deutschland bleibe auf Energieimporte angewiesen, so Dr. Bömeke, weshalb stabile Partnerschaften und wirtschaftlich sinnvolle Produktionsstandorte entscheidend seien. Prof. Küchen hob hervor, dass Kohlenwasserstoffe in bestimmten Bereichen weiterhin benötigt würden. Für Investitionen brauche es klare CO₂-Bepreisung, verlässliche Quotenregelungen und eine pragmatische Wasserstoffstrategie. Auch CCS-Technologien seien notwendig, doch es fehle an koordinierter Regulierung auf EU- und Bundesebene. Ein weiteres zentrales Diskussionsthema bildete die Finanzierung der Energiewende. Nach Meinung von Dr. Rolle reiche das Sondervermögen allein nicht aus. Vielmehr seien höhere Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette nötig, für die privates Kapital stärker mobilisiert werden müsse. Dafür seien stabile politische Rahmenbedingungen unerlässlich. Gleichzeitig müsse die Energieeffizienz gesteigert und die europäische Eigenproduktion gestärkt werden.
Kommunale Energiewende – Bundesregulierung trifft ländliche Realität
Als zweites Thema der parallelen Sessions am Nachmittag stand die Umsetzung der Bundesregulierung zur Energiewende auf kommunaler Ebene auf der Tagesordnung. In einem Impulsvortrag unterstrich Stefan T. Sziwek, Geschäftsführer der Varem Energie GmbH, die Bedeutung der Bioenergie für die Energiewende. Die geplanten 20 Gigawatt Gaskraftwerke könnten zwar nicht vollständig mit Biogas betrieben werden, doch könne Bioenergie einen signifikanten Beitrag leisten, insbesondere über die Nutzung von Abfällen und Reststoffen. Solche Anlagen ließen sich privatwirtschaftlich finanzieren und trügen zur Senkung von Treibhausgasemissionen bei. Michael Raschemann, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, stellte das Beispiel Feldheim, Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen in Brandenburg, vor, welches seit 2010 vollständig mit Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien versorgt wird. Ermöglicht werde dies durch gemeinschaftliche Investitionen in Windkraft, Biogasanlagen, ein eigenes Nahwärmenetz und ein neues Stromnetz.
In der anschließenden Diskussion unter der Moderation von Dr. Christoph Löwer, Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, berieten Dr. Frederike Haase, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Dr. Kay Ruge, Beigeordneter, Deutscher Landkreistag, Michael Raschemann und Stefan T. Sziwek über politische, wirtschaftliche und regulatorische Hürden. Dr. Haase forderte digitale Genehmigungsverfahren und warnte vor der Zweckentfremdung von Sondervermögen. Dr. Ruge sprach sich für eine stärkere kommunale Einbindung und gezielte regionale Förderung aus. Sziwek kritisierte die mangelnde Verlässlichkeit gesetzlicher Rahmenbedingungen, während Raschemann für mehr Mut, Beteiligung und eine lösungsorientierte Bürokratie plädierte. Einigkeit bestand in der Bewertung, dass erfolgreiche Projekte stärker sichtbar gemacht werden müssten. Mit den geeigneten Rahmenbedingungen könne der ländliche Raum eine tragende Rolle bei der Energiewende übernehmen.
Energiepolitische Weichenstellung in der neuen Legislaturperiode
Den Abschluss des ersten Tages bildete das Panel „Energiepolitische Weichenstellung in der neuen Legislaturperiode“ mit den Diskutanten Thomas Bareiß, MdB (CDU/CSU), Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Industriellen Energie- & Kraftwirtschaft (VIK), und Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne). Unter der Moderation von Ulrike Drachsel wurde die Frage beleuchtet, wie die Transformation zur Klimaneutralität wirtschaftlich gestaltet werden könne. Ein Aspekt dabei war der technologie- und innovationsgetriebene Wasserstoffhochlauf, der von allen Teilnehmern befürwortet wurde. Außerdem ging es um den Hochlauf der Elektromobilität, insbesondere mit Blick auf den Stellenabbau in der Automobilindustrie. Fazit dieser Diskussion war, dass grundsätzliche, wirtschaftliche Reformen nötig seien, um bei beiden Bereichen ein Geschäftsmodell zu realisieren. Ein weiterer Punkt betraf die Diversifizierung der internationalen Partnerschaften Deutschlands. Dabei wurde auch die Notwendigkeit eines stärkeren europäischen Handels betont, der Energiebinnenmarkt müsse ernstgenommen werden. Sowohl die deutsche als auch die europäische Wirtschaft müssten resilienter werden, um die aktuellen politischen Herausforderungen zu meistern. Ein entscheidendes Problem für Deutschland sei dabei der nicht wettbewerbsfähige Strompreis, den es unter anderem durch eine effizientere Nutzung und Digitalisierung der bestehenden Netze zu senken gelte.
Im Eröffnungsplenum des zweiten Tages von ENERGIE.CROSS.MEDIAL lag der Schwerpunkt auf dem energiepolitischen Zieldreieck der Energiewende. Besonders die Einordnung der bisherigen Zielerreichung aus behördlicher Perspektive brachte neue Erkenntnisse, auf die in den darauffolgenden Themensessions Bezug genommen wurde. Die Ausführungen der Präsidenten des Bundesrechnungshofes und der Bundesnetzagentur zeigte, dass auch zwischen den Behörden unterschiedliche Schwerpunkte in der Umsetzung der Energiewende gesetzt werden. Gleichzeitig wurde im Verlauf des Tages deutlich, wie wichtig die Digitalisierung in der Energiewende ist und welche entscheidende Rolle eben dieser zukommt. Anschließend wurde das Heizungsgesetz aus wirtschaftlicher und politischer Perspektive bewertet. Am Ende des Tages wurde erneut über die Energiepolitischen Weichenstellungen mit politischen und wirtschaftlichen Stakeholdern diskutiert, um die Wünsche und Forderungen an die neue Bundesregierung zu formulieren.
Bewertung der Umsetzung der Energiewende aus der Sicht des Bundesrechnungshofes
Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofes, verwies auf die Rückstände beim Ausbau der Windenergie. Trotz Rekordzahl der Genehmigungen sei ein spürbarer Zubau frühestens ab 2026 zu erwarten. Dabei bleibe die Umsetzung der Kraftwerkstrategie unklar, ebenso bestünden laut Scheller erhebliche Defizite beim Netzausbau. Steigende Strompreise belasteten Haushalte und Industrie, während ein wirksames Monitoring der Umweltwirkungen fehle. Scheller warnte davor, dass die Energiewendeziele verfehlt werden könnten – mit Risiken für Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. Entschlossene Maßnahmen seien notwendig, um Wohlstand und Klimaschutz zu sichern.
Wie weiter bei Versorgungssicherheit und Netzentgelten?
Klaus Müller, Präsident, Bundesnetzagentur, stellte klar, dass die Energieversorgung auch in kritischen Phasen wie Dunkelflauten gesichert sei. Der vergangene Winter habe einen normalen Gasverbrauch ohne Engpässe aufgezeigt, die Gaspreise blieben jedoch auf einem besorgniserregenden Niveau. Mit Bezug auf den Netzausbau verwies Müller auf deutliche Fortschritte, da Investitionen und genehmigte Trassenkilometer stark gestiegen seien. Auch 2025 sei mit weiterem Wachstum zu rechnen. Gleichzeitig betonte er den hohen Investitionsbedarf für Instandhaltung sowie die Notwendigkeit, System- und Redispatchkosten zu senken. Zentrale Forderungen richteten sich auf einen zügigen Bau moderner Gaskraftwerke zur Absicherung der Versorgungssicherheit und die Prüfung eines Kapazitätsmarkts. Alle Effizienzpotenziale im System müssten genutzt werden, etwa bei der Wahl zwischen Erdkabeln und Freileitungen, so Müller.
Klimaschutz in Deutschland – Wo stehen wir, was wollen wir, und was ist noch zu tun?
Prof. Dr. Manfred Fischedick, Präsident des Wuppertal Instituts, gab zu bedenken, dass Deutschland trotz Fortschritten seine Klimaziele für 2030 voraussichtlich verfehlen werde. Laut Umweltbundesamt werde die angestrebte Emissionsminderung von 65 Prozent wohl nur zu 63 Prozent erreicht. Besonders in den Sektoren Verkehr und Gebäude bestehe erheblicher Nachholbedarf, hob Fischedick hervor. Die Emissionslücke im Rahmen der EU-Klimaschutzverordnung könne bis 2030 auf 226 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente anwachsen. Er kritisierte zudem das Ausbleiben zentraler Maßnahmen wie Klimageld, Abbau fossiler Subventionen und Klimacheck sowie die Abschaffung der Sektorziele, die den Handlungsdruck verringere.
Energiewende 2.0: Digitalisierung und KI als Gamechanger
Die Themensession 5 beschäftigte sich mit Digitalisierung und KI und zeigte auf, wie zentrale Hebel in der Energiewende und der industriellen Transformation genutzt werden könnten, vorausgesetzt, es werde in Infrastruktur, Datenzugang und in Fachkräfte investiert. Christian Klöppel, Geschäftsführer von Techem X, Merlin Lauenburg, Geschäftsführer der Tibber Deutschland GmbH, Dr. Malte Sunderkötter, Geschäftsführer der E.ON Grid Solution, Dr. Matthias Bölke, Chairman IDTA und VP Strategy bei Schneider Electric, und Nina Stock, Oberregierungsrätin Digitalisierung und Industrie 4.0 im BMWK, diskutierten unter der Moderation von Dr. Marian Klobasa, Geschäftsfeldleitung Energiemanagement und intelligente Netze beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, über die Chancen der Digitalisierung in der Energiewende und welche Hürden zu überwinden sein werden.
Klöppel betonte das Potenzial smarter Technologien im Gebäudesektor, insbesondere durch eine zentrale Erfassung und Analyse von Energieströmen. Voraussetzung für eine wirksame Optimierung sei jedoch auch die Einbindung des Nutzerverhaltens. Dr. Bölke unterstrich die Bedeutung skalierbarer Digitalisierungs-Lösungen für den europäischen Maschinenbau, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Dr. Sunderkötter verwies auf den Rückstand beim Smart-Meter-Rollout, der als Grundlage für ein flexibles Energiesystem gilt. Außerdem müssten Netzbetreiber mehr Steuerungsmöglichkeiten erhalten. Auch Lauenburg hob hervor, dass dynamische Stromtarife erst durch Smart Meter realisierbar würden, und forderte vereinfachte Prozesse im Messwesen.
In der Diskussion wurde deutlich, dass moderne Energieverteilungssysteme hochkomplex sind und digitale Zwillinge sowie offene Datenräume, wie etwa in den Projekten Catena-X oder Manufacturing-X, zentrale Bausteine für Vertrauen und Kooperation darstellen. Der Fachkräftemangel wurde als zentrales Hindernis benannt – es fehle an Talenten und frühzeitiger Förderung. Abschließend waren sich die Teilnehmenden einig, dass Digitalisierung und KI nur dann ihr volles Potenzial entfalten können, wenn regulatorische Hürden abgebaut, offene Datenstrukturen gefördert und Menschen gezielt befähigt werden, die Transformation aktiv mitzugestalten.
Heizungsgesetz 2025: Erfolg oder neues Debakel?
In Session 6 leitete unter der Überschrift „Heizungsgesetz 2025: Erfolg oder ein neues Debakel?“ Dr. Andreas Stücke, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Verband Flüssiggas (DVFG), mit einem Impulsreferat zur regulatorischen Ausgestaltung der Energiewende ein. Er sprach sich für eine Verschiebung des Klimaneutralitätsziels auf 2050, die Einführung eines einheitlichen Klimageldes sowie die Streichung der Länderöffnungsklausel im Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus.
Diese Vorschläge wurden von Jobst-Dietrich Diercks, Vorstandsvorsitzender des DVFG, Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, Geschäftsführer des ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH, und Helmut Kleebank, MdB, SPD, unter der Moderation von Fanny Fee Werther, Moderatorin beim WELT-Nachrichtensender, erörtert. Dabei wurde deutlich: Die Energiewende benötigt weniger neue Zielvorgaben, stattdessen mehr Umsetzungsstärke. Während Kleebank die Festlegung des Klimaziels 2045 verteidigte, plädierte Diercks für mehr gesellschaftliche Akzeptanz mit Hilfe eines realistischeren Zieljahres 2050. Prof. Oschatz forderte konkrete Anpassungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Einigkeit bestand darin, dass eine schrittweise „Evolution“ zielführender sei als radikale Umbrüche. Die Teilnehmenden forderten technologieoffene sowie marktwirtschaftlich orientierte Lösungen und betonten die Bedeutung von Planungssicherheit – insbesondere im Zuge des Kohleausstiegs und beim Aufbau neuer Erzeugungskapazitäten wie Gaskraftwerken. Sorge bereiteten die hohen Energiepreise und die ungleiche Verteilung der Netzentgelte. Diese gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit und führten zu regionalen Ungleichgewichten. Eine verursachungsgerechte Finanzierung des Netzausbaus sowie stabile, langfristige Rahmenbedingungen wurden als zentrale Voraussetzungen für Investitionen genannt. Abschließend wurde ein parteiübergreifender energiepolitischer Grundkonsens gefordert, um die Transformation der Energiewirtschaft verlässlich und zukunftsfähig zu gestalten.
Energiepolitische Weichenstellung in der neuen Legislaturperiode
An der für den zweiten Veranstaltungstag angesetzten Diskussion über die energiepolitische Weichenstellung in der neuen Legislaturperiode beteiligten sich Saskia Ludwig, MdB (CDU/CSU), Dr. Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Amprion GmbH, Gilles Le Van, Vice President Large Industries and Energy Transition Central Europe bei Air Liquide Deutschland GmbH, und Silvio Konrad, Vorsitzender der Geschäftsführung der TÜV NORD EnSys unter der Moderation von Ulrike Drachsel. Debattiert wurde im Einzelnen darüber, wie es der neuen Bundesregierung gelingen kann, die wirtschaftliche Stärke Deutschlands zu sichern, ohne dabei die Klimaziele aus dem Blick zu verlieren. Unter den Teilnehmenden aus Politik und Wirtschaft herrschte Einigkeit darüber, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Tragfähigkeit kein Widerspruch sein dürfen, sondern zusammengedacht werden müssen. Die vergangenen Jahre seien vielfach von einer ideologiegetriebenen Debatte geprägt gewesen – nun brauche es eine Rückbesinnung auf Pragmatismus, marktwirtschaftliche Prinzipien und umsetzungsorientiertes Handeln. Deutschland habe kein Ziel-, sondern ein Umsetzungsproblem zu lösen. Statt neuer Szenarien seien konkrete Maßnahmen und technologieoffene Ansätze erforderlich – etwa durch den Einsatz von CCS in schwer dekarbonisierbaren Industrien. Dabei bleibe die Akzeptanz in der Bevölkerung eine zentrale Herausforderung.
Weiterhin erfordere die Wahrung der Versorgungssicherheit im Zuge des Kohleausstiegs den parallelen Aufbau neuer Erzeugungskapazitäten wie Gaskraftwerke sowie eine verlässliche Reservestrategie. Eine sich rein auf die Nutzung regenerativer Quellen stützende Energieversorgung sei kurzfristig nicht realistisch.
Schließlich gefährdeten die hohen Energiepreise laut Aussagen der Wirtschaft deren Wettbewerbsfähigkeit und führten zu Standortverlagerungen. Planungssicherheit und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen seien daher essenziell. Auch die ungleiche Verteilung der Netzentgelte wurde kritisiert. Forderungen nach einer verursachungsgerechten Finanzierung und dem Vorrang für Erdkabel wurden jedoch kontrovers diskutiert.
Abschließend wurde ein parteiübergreifender energiepolitischer Grundkonsens gefordert, um langfristige Investitionssicherheit zu gewährleisten und die Transformation erfolgreich zu gestalten.
Unsere Partner
ENERGIE.CROSS.MEDIAL wird in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zukunftsenergien e.V. realisiert.
Alle Neuigkeiten zu ENERGIE.CROSS.MEDIAL finden Sie auch auf X (Twitter) @EnergieXMedial und auf LinkedIn.